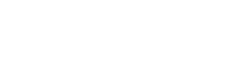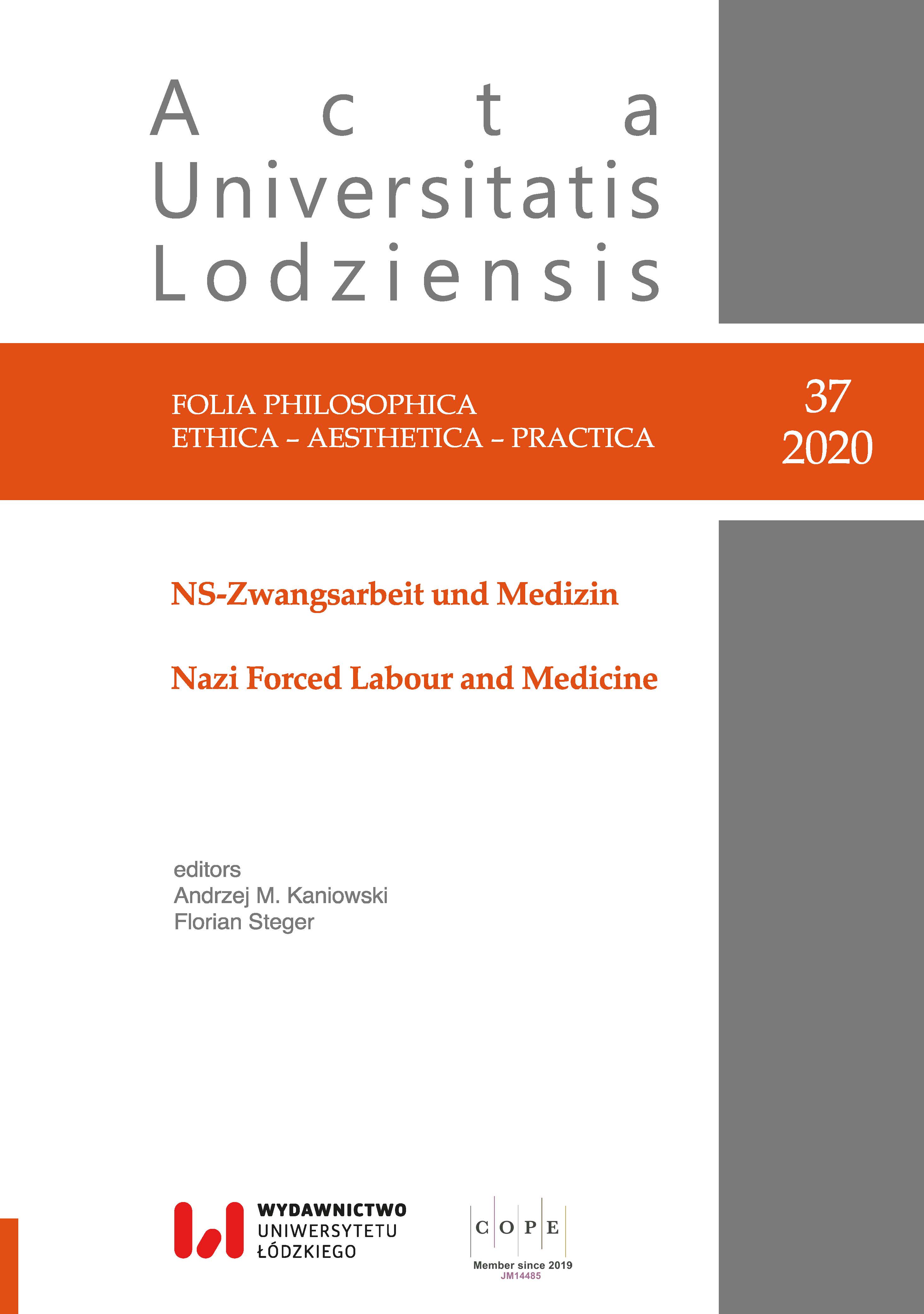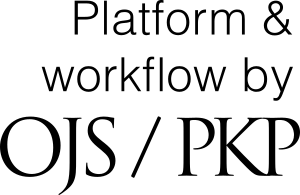Medizinische Versorgung polnischer Zwangsarbeiter in der Region Bielefeld
DOI:
https://doi.org/10.18778/0208-6107.37.06Schlagworte:
Nationalsozialismus, Zwangsarbeit, polnische Zwangsarbeiter, medizinische VersorgungAbstract
Polnische und sowjetische Zwangsarbeiter, die in der nationalsozialistischen Ideologie als „Untermenschen“ galten, waren die am stärksten diskriminierten Nationalitäten unter den ausländischen Beschäftigten in der Kriegswirtschaft des „Dritten Reiches“. Ihre gesamten Lebens- und Arbeitsbedingungen waren der Rassenideologie untergeordnet. Diese Ideologie vertrug sich in hervorragender Weise mit der systematischen Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. Das Ergebnis des Zwangsarbeitersystems war ein völlig repressives, sogar unmenschliches System mit miserablen Lebensbedingungen und minderwertiger medizinischer Versorgung. Sowohl die Lebensbedingungen als auch die medizinische Behandlung zeigen wie in einem Brennglas die Hauptziele des NS-Staates und seinen rassistischen und entmenschlichten Charakter.
Die im Nordosten Westfalens gelegene Stadt und der Landkreis Bielefeld sind aufgrund ihres gemischt industriellen und landwirtschaftlichen Charakters ein repräsentatives Beispiel für das brutale und repressive System der Zwangsarbeitsindustrie und spiegelt so das gesamte Spektrum der mit der Zwangsarbeit verbundenen Probleme wider. Die Analyse der medizinischen Versorgung im Raum Bielefeld ermöglicht die Unterscheidung zweier Gruppen polnischer Zwangsarbeiter. Die erste Gruppe besteht aus Personen, die in der Industrie beschäftigt sind, während die andere Gruppe eine gemischte Kategorie ist, die Arbeitnehmer aus den Bereichen Landwirtschaft, Dienstleistungssektor und Haushaltshilfe in Privathaushalten umfasst. In der ersten Gruppe war der Status der Arbeitnehmer in der Regel standardisiert. Die meisten von ihnen wurden in den Lagern untergebracht und einer brutalen und systematischen Ausbeutung unterzogen, die darauf ausgerichtet war, die Produktionseffekte zu maximieren und gleichzeitig Personen infolge widriger Arbeits- und Unterbringungsbedingungen und minimaler medizinischer Versorgung zu vernichten. Diese unmenschliche Behandlung war ein Derivat der rassistischen Ideologie. Status, Beschäftigungsbedingungen und medizinische Versorgung in der zweiten Gruppe waren viel uneinheitlicher und stärker von ganz unterschiedlichen Bedingungen abhängig. Wir haben es hier mit einer breiten Palette von Problemen zu tun, oft verbunden mit extrem unterschiedlichen Erfahrungen von Zwangsarbeitern mit dem medizinischen Personal und unterschiedlichen Einstellungen der Arbeitgeber zu den Zwangsarbeitern. Begrenzt wird die Aussagekraft unserer Darstellung durch die oft beschränkte Quellenlage. Insbesondere betrifft das den begrenzten Fundus an schriftlich festgehaltenen Erinnerungen der Zwangsarbeiter. Heute ist es praktisch unmöglich, das Quellenreservoir zu erweitern, da die Zeugen dieser Ereignisse nicht mehr zur Verfügung stehen.
Literaturhinweise
Anschütz, Janet, Heike Irmtraud. „Medizinische Versorgung von Zwangsarbeitern in Hannover. Forschung und Zeitzeugenberichte zum Gesundheitswesen.“ In Zwangsarbeit und Gesundheitswesen im Zweiten Weltkrieg. Einsatz und Versorgung in Norddeutschland. Hg. von Günter Siedbürger und Andreas Frewer. Hildesheim, Zürich, New York: Olms, 2006.
Google Scholar
Benad, Matthias, Regina Mentner (Hg.). Zwangsverpflichtet. Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter(-innen) in Bethel und Lobetal 1939–1945. Bielefeld: Bethel-Verlag, 2002.
Google Scholar
Freitag, Gabriele. Zwangsarbeiter im Lipper Land. Der Einsatz von Arbeitskräften aus Osteuropa in der Landwirtschaft Lippes 1939–1945. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 1996.
Google Scholar
Gastwirtschaft „Vadder Ertel“ in Schildesche – Arbeitskommando des Stalag VI A. Dokumentation der Erinnerungen von Zwangsarbeiter(-innen) – Kriegsgefangenen an Bielefeld 1939–1945. Eine Dokumentation der Klasse 10a der Martin-Niemöller-Gesamtschule Bielefeld. Bielefeld: Oberstufen-Kolleg, 1998.
Google Scholar
Herrenmenschen – Untermenschen. Erinnerungen ehemaliger polnischer und ukrainischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter an ihre Zwangsarbeit im Raum Bielefeld 1939 bis 1945. Projektbericht des Wahlfachkurses Soziologie am Oberstufen-Kolleg der Universität Bielefeld. Redaktion: Hans-Georg Pütz. Bielefeld, Juni, 2001 (die Aussagen der Zwangsarbeiter entstammen der Interviewsammlung des Kursleiters des Wahlfachkurses Soziologie, Hans-Georg Pütz, die dem Autor zur Verfügung gestellt wurde).
Google Scholar
Herbert, Urlich. Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. Bonn: Dietz, 1999.
Google Scholar
Hodorowicz-Knabb, Sophie. Naznaczone literą „P”. Polki jako robotnice przymusowe w III Rzeszy 1939–1945. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.
Google Scholar
Hrabar, Roman. Skazane na zagładę. Praca niewolnicza polskich kobiet w III Rzeszy i los ich dzieci. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1989.
Google Scholar
Kettermann, Günter. Kleine Geschichte der Bielefelder Wirtschaft vornehmlich im 19. und 20. Jahrhundert. Bielefeld: Pfeffersche Buchhandlung, 1985.
Google Scholar
Kühne, Hans Jörg. Kriegsbeute Arbeit. Der „Fremdarbeitereinsatz“ in der Bielefelder Wirtschaft 1939–1945. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 2002.
Google Scholar
Kwieciński, Wojciech. Polscy robotnicy przymusowi w regionie bielefeldzkim podczas drugiej wojny światowej (1939–1945). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
Google Scholar
Lechner, Silvester (Hg.) Schönes, schreckliches Ulm. 130 Berichte ehemaliger polnischer Zwangsarbeiter die in den Jahren 1940 bis 1945 in die Region Ulm/Neu Ulm verschleppt worden waren. Ulm: Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e.V., KZ-Gedenkstätte 1996.
Google Scholar
Łuczak, Czesław. Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny światowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1974.
Google Scholar
Rusiński, Władysław. Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939–1945 na terenie Rzeszy i „obszarów wcielonych”. Band II. Poznań: Instytut Zachodni, 1955.
Google Scholar
Schwarze, Gisela. Kinder, die nicht zählten – Ostarbeiterinnen und ihre Kinder im Zweiten Weltkrieg. Essen: Klartext, 1997.
Google Scholar
Siegfried, Klaus-Jörg. Das Leben der Zwangsarbeiter im Volkswagenwerk 1939–1945. Frankfurt am Main, New York: Campus, 1988.
Google Scholar
Spoerer, Mark. Praca przymusowa pod znakiem swastyki. Cudzoziemscy robotnicy, jeńcy wojenni i więźniowie w Niemczech i okupowanej Europie w latach 1939–1945. Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2015.
Google Scholar
Stefanski, Valentina Maria. Zwangsarbeit in Leverkusen: polnische Jugendliche im I.G. Farbenwerk. Osnabrück: Fibre, 2000.
Google Scholar
Szurgacz, Herbert. Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939–1945. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Ossolineum, 1971.
Google Scholar
Witt, Jan. Vom Saisonarbeiter zum Zwangsarbeiter. Voraussetzungen und Etablierung des „Ausländereinsatzes“ im Raum Minden 1939–1942. Magisterarbeit Universität Bielefeld 2000.
Google Scholar
Downloads
Veröffentlicht
Zitationsvorschlag
Ausgabe
Rubrik
Lizenz

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International.