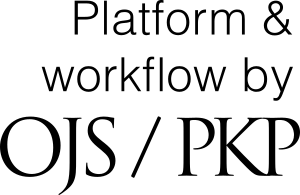Was ist ,typisch‘ in einer Kultur? Kriterien der Kulturspezifik am Beispiel von polnischen Sprichwörtern
DOI:
https://doi.org/10.18778/2196-8403.2012.11Schlagworte:
Stereotype, Polemik, Identität, eigene Prespektive, fremde PerspektiveAbstract
Am Beispiel scheinbar ‚typischer‘ polnischer Sprichwörter wird in dem vorliegenden Beitrag gezeigt, dass das ‚Typische‘ einer Kultur als Ergebnis einer diskursiven, mitunter strittigen oder auch spöttischen Auseinandersetzung darüber aufzufassen ist. Die Zuschreibung von Identität resultiert danach aus der permanenten Auseinandersetzung einer Kultur darüber, was aus einer eigenen oder fremden Perspektive als kulturell unverwechselbar angesehen wird.
Literaturhinweise
BARTOSZEWICZ, IWONA (1994): Analoge Sprichwörter im Deutschen, Niederländischen und Polnischen. Eine konfrontative Studie. Wrocław (=Acta Universitatis Wratislaviensis 1464).
Google Scholar
BAUSINGER, HERMANN (22000): Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen? München.
Google Scholar
CHMIELOWSKI, BENEDYKT (1745/46): Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna, na różne tytuły jak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana. [Neues Athenäum oder Akademie aller vollständigen Wissenschaften, in verschiedene Titel und Klassifikationen unterteilt, den Klugen zum Memorieren, den Idioten zur Lehr, den Politikern zum Gebrauch, den Melancholikern zur tatkräftigen Erheiterung]. Lwów.
Google Scholar
Duden (22002): Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim.
Google Scholar
DURAND, BEATRICE (2010): Die Legende vom typischen Deutschen. Eine Kultur im Spiegel der Franzosen. Leipzig.
Google Scholar
FÖLDES, CSABA (ed.) (2003): Interkulturelle Linguistik. Vorüberlegungen zu Konzepten, Problemen und Desiderata. Wien (=Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement 1).
Google Scholar
FÖLDES, CSABA (ed.) (2004): Res Humanae Proverbiorum et Sententiarum. Ad honorem Wolfgangi Mieder. Tübingen.
Google Scholar
GELFERT, HANS (2005): Was ist deutsch? Wie die Deutschen wurden, was sie sind. München.
Google Scholar
GŁUSKI, JERZY (1971): Proverbs. Ein komparatives Buch über englische, französische, deutsche, italienische und russische Sprichwörter mit lateinischem Zusatz. Amsterdam/London/New York.
Google Scholar
GORSKI, MAXIM (2006): Gebrauchsanweisung für Deutschland. München.
Google Scholar
HANSEN, ERIC T. (2007): Planet Germany. Eine Expedition in die Heimat des Hawaii- Toasts. Unter Mitarbeit von Astrid Ule. Frankfurt (M.).
Google Scholar
HEINEMANN, MARGOT (ed.) (1998): Sprachliche und soziale Stereotype. Frankfurt (M.) (=Forum Angewandte Linguistik 33).
Google Scholar
KŁOSIŃSKA, KATARZYNA (2004): Słownik przysłów czyli przysłownik. [Wörterbuch der Sprichwörter]. Warszawa.
Google Scholar
KŁOSIŃSKA, ANNA / SOBOL, ELŻBIETA / STANKIEWICZ, ANNA (eds.) (2005): Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. [Das große phraseologische PWNWörterbuch samt Sprichwörtern]. Warszawa.
Google Scholar
KOPALIŃSKI, WŁADYSŁAW (32004): Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. [Das Wörterbuch der Ereignisse, Termini und der Legenden des 20. Jahrhunderts.]. Warszawa.
Google Scholar
KOWALIKOWA, JADWIGA (2001): Przysłowia jako komunikaty. [Sprichwörter als Kommunikate]. In: HABRAJSKA, GRAŻYNA (ed.) (2001): Język w komunikacji. Tom II. Łódź, 112-117.
Google Scholar
KRAMSCH, CLAIRE (1993): Context and culture in language teaching. Oxford.
Google Scholar
KRZYŻANOWSKI, JULIAN (ed.) (1970): Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom II. [Das neue Buch der Sprichwörter und der sprichwörtlichen polnischen Redewendungen. Bd. 2]. Warszawa.
Google Scholar
LAKOFF, GEORGE / JOHNSON, MARK (22000): Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Astrid Hildenbrand. Heidelberg.
Google Scholar
LEWANDOWSKA, ANNA (2008): Sprichwort-Gebrauch heute. Ein interkulturellkontrastiver Vergleich von Sprichwörtern anhand polnischer und deutscher Printmedien. Bern (=Sprichwörterforschung 26).
Google Scholar
LEWANDOWSKA, ANNA / ANTOS, GERD (2004): Sprichwörter als kulturelle Metaphern oder „Warum gebrauchen wir heute noch Sprichwörter?“ Ein kultur-kognitiver Erklärungsversuch. In: FÖLDES, 167-186.
Google Scholar
LEWANDOWSKA, ANNA / ANTOS, GERD (2011): Methoden des linguistischen Zugangs zu ‚Interkulturalität‘. In: FÖLDES, CSABA (ed.): Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode. Tübingen, 137-155 (=Beiträge zur Interkulturellen Germanistik 3).
Google Scholar
LUECKEL, GORDON / THIELE, JOHANNES (eds.) (2009): Deutschland. Das Buch. Erleben, was es bedeutet. München/Wien.
Google Scholar
MIEDER, WOLFGANG (1995): Sprichwörtliches und Geflügeltes. Sprachstudien von Martin Luther bis Karl Marx. Bochum (=Studien zur Phraseologie und Parömiologie 4).
Google Scholar
MIEDER, WOLFGANG (1998): Verdrehte Weisheiten. Antisprichwörter aus Literatur und Medien. Wiesbaden.
Google Scholar
PERMJAKOV, GRIGORIJ L. (2000): Die Grammatik der sprichwörtlichen Weisheit. In: GRZYBEK, PETER (ed.): Die Grammatik der sprichwörtlichen Weisheit von G.L. Permjakov. Mit einer Analyse allgemein bekannter deutscher Sprichwörter. Hohengehren, 43-104.
Google Scholar
SABBAN, ANNETTE / WIRRER, JAN (eds.) (1991): Sprichwörter und Redensarten im interkulturellen Vergleich. Opladen.
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-97010-7
SZPILA, GRZEGORZ (2003): Krótko o przysłowiu. [Kurz zum Sprichwort]. Kraków.
Google Scholar
ŚWIERCZYŃSKA, DOBROSŁAWA (2001): Przysłowia są ... na wszystko. [Sprichwörter sind … für jede Gelegenheit]. Warszawa.
Google Scholar
TANIKOWSKI, ARTUR (2005): Sarmacki świat. Co łączy husarskiego orła z amorkiem w kontuszu. [Die Welt der Sarmaten. Was den Husaren-Adler mit einem Amor im Oberrock verbindet]. In: Przegląd Polski.
Google Scholar
TWARDOWSKI, JAN (1989): Nie przyszedłem pana nawracać. [Ich bin nicht gekommen, Sie zu bekehren]. Warszawa.
Google Scholar
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN (2005). [Das universelle Wörterbuch der polnischen Sprache]. CD-ROM.
Google Scholar
WALDENFELS, BERNHARD (2006): Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt (M.).
Google Scholar
Downloads
Veröffentlicht
Zitationsvorschlag
Ausgabe
Rubrik
Lizenz

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International.